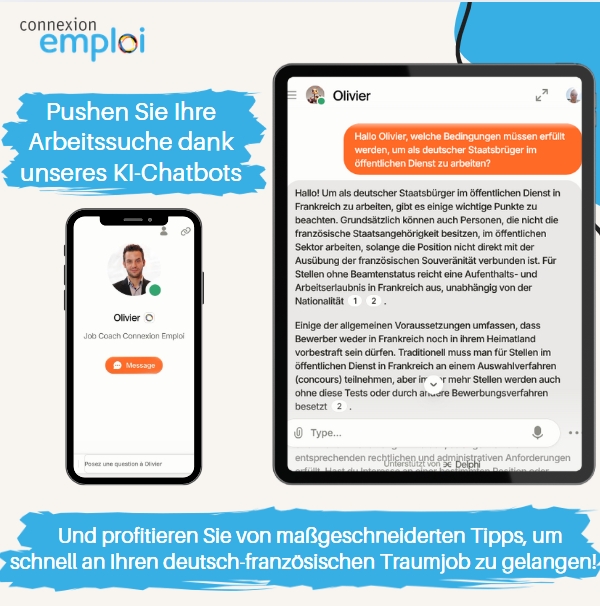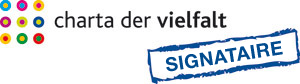Vergleich der Familienpolitik in Frankreich und Deutschland

Deutschland und Frankreich haben viele Gemeinsamkeiten, ob wirtschaftlich, institutionell oder politisch. Bei der Geburtenrate und der Vollzeiterwerbstätigkeit von Frauen, könnten die Unterschiede größer nicht sein. Wir erklären Ihnen warum beide Länder wie zwei ungleiche Schwestern bei der Familienpolitik wirken.
2. Gezwungen sich zwischen Familie und Beruf zu entscheiden
3. Je mehr eine Frau arbeitet, desto mehr Kinder hat sie
4. Gehaltsvergleich zwischen Frauen in Frankreich und Deutschland
5. Deutschlands Frauenpolitik hat Nachholbedarf

Es fängt schon damit an, dass Frauen in Deutschland beruflich viel schlechter gestellt sind als in Frankreich: Gerade im Niedriglohnsektor arbeiten vor allem junge und alleinerziehende Mütter. Des Weiteren sind viele Mütter in Teilzeit tätig:
- 66 % der Mütter in Deutschland arbeiten in Teilzeit
- 35 % der Mütter in Frankreich arbeiten in Teilzeit
Insgesamt bedeutet das für die Situation von deutschen Müttern, dass sie viel stärker mit niedrigen Gehältern, unsicheren Arbeitsplätzen, geringen Aufstiegschancen und ungünstigen Arbeitszeiten konfrontiert und damit letztendlich einer unvollständigen sozialen Absicherung ausgesetzt sind. Dies betrifft im Übrigen auch Mütter mit höherem Bildungsabschluss und älteren Kindern.
Aber warum arbeiten so viele Frauen in Deutschland in Teilzeit? Vielen bleibt keine andere Wahl. Sie versprechen sich, aufgrund des Mangels an Betreuungsangeboten für Kinder, von dieser Beschäftigungsform eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Denn nach wie vor gilt in Deutschland die Erziehung von Kindern als Frauensache, dagegen können Eltern in Frankreich viel stärker auf staatliche Institutionen bei der Kinderbetreuung bauen.
In Deutschland tragen Frauen immer noch die Hauptverantwortung für Kindererziehung und Haushalt und wählen mit diesem Bewusstsein oft von vornherein eine geringere Ausbildung oder geben sich mit Beschäftigungen zufrieden, für die sie überqualifiziert sind.
Nach der Geburt eines Kindes wird die Erwerbstätigkeit oft ganz unterbrochen. Folglich gestaltet sich ein Wiedereinstieg als schwierig und ist häufig nur über die erwähnte Teilzeitbeschäftigung oder einer Anstellung unterhalb des eigentlichen Bildungsniveaus möglich.
Dadurch werden Frauen in Deutschland immer benachteiligt. Die Berufsunterbrechungen und das niedrige Gehalt führen zu großen Unterschieden zu Männern oder Kinderlosen, beispielsweise bei der Höhe der Rente und der sozialen Absicherung. Damit sind deutsche Frauen viel stärker dem Risiko einer finanziellen Abhängigkeit und der Altersarmut ausgesetzt als in Frankreich.
Der Erwerbsarbeitszyklus von Frauen in Deutschland ist in drei deutlich voneinander abgegrenzte Abschnitte gegliedert:
- die Phase der Erwerbsarbeit
- die Familienphase
- die Berufsrückkehr
Kurz gesagt: In Deutschland müssen sich Frauen viel stärker zwischen Beruf und Karriere entscheiden.
In Frankreich haben Frauen dagegen die Möglichkeit, nach der Geburt eines Kindes, schnell wieder in ihre Vollzeitbeschäftigung zurückzukehren. So arbeiten 40 % aller Mütter mit Kindern ab 5 Jahren Vollzeit, wohingegen in Deutschland bei 50 % der Paare mit Kindern nur der Vater arbeitet.
In Frankreich sind also Familien- und Berufsphasen von Frauen durch das flächendeckende Angebot an staatlichen Kinderbetreuungseinrichtungen nicht so stark voneinander abgegrenzt. Sie bleiben in ihrem Beruf und sind finanziell unabhängig.

Diese Sicherheit fehlt deutschen Müttern sehr häufig, und das scheint auch einen unmittelbaren Einfluss auf die Geburtenrate zu haben, die im Durchschnitt in Deutschland mit 1,4 Kindern pro Frau gegenüber 1,8 Kindern in Frankreich dramatisch gering ist.
Der Anteil der Frauen, die aufgrund des "Entscheidungszwangs" in Deutschland keine Kinder bekommen, ist sehr hoch. Schätzungen zufolge sind fast ein Drittel aller Frauen betroffen. Bei Akademikerinnen liegt dieser Anteil sogar bei über 40 %.
Dagegen bleibt in Frankreich nur jede zehnte Frau kinderlos. Dabei ist der Anteil von Familien mit mehr als drei Kindern hier viel höher: Je mehr eine Frau in Frankreich Karriere macht, desto mehr Kinder bekommt sie.
Die geschlechtsspezifischen Lohnunterschiede in Frankreich fallen deutlich höher als in Deutschland aus.
Die durchschnittlichen Bruttolöhne von Frauen sind in Deutschland um 18 % niedriger als die der Männer, in Frankreich sind es gar 24 %!

Dass das System staatlicher Kinderbetreuung in Deutschland wesentlich dazu beiträgt, dass es Frauen schwerfällt, Kinder und Karriere zu vereinbaren, liegt auf der Hand.
Aber auch die unterschiedlichen Ansätze in den gesellschaftlichen Wertevorstellungen und Normen in der Arbeitsmarkt-, Sozial-, Gleichstellungs- und Bildungspolitik und in dem System der finanziellen Unterstützung von Familien in Deutschland und Frankreich haben einen großen Einfluss.
Wo in Frankreich die Gleichstellung von Männern und Frauen regelrecht ein Querschnittsthema ist, das sich durch alle Politikbereiche zieht, werden Frauen in Deutschland schneller aus dem Erwerbsleben gedrängt. Dabei hat Deutschland in puncto Förderung der Berufstätigkeit von Frauen einiges nachzuholen.
Dass die Geburt eines Kindes für eine Frau nicht bedeuten muss, auf das berufliche Abstellgleis gestellt zu werden, ist vielleicht einer der Gründe dafür, dass Frankreich die höchste Geburtenrate in Europa hat, gefolgt von Tschechien, Island und Rumänien.
Mehr dazu:



 Fr
Fr De
De En
En