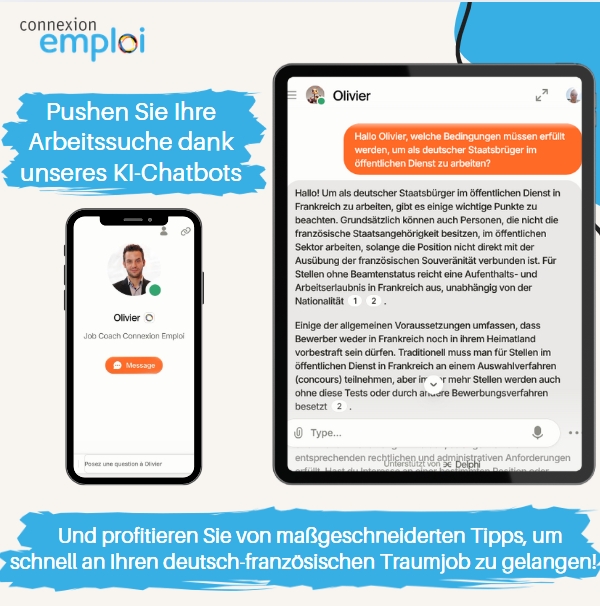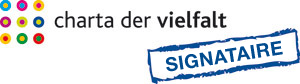Scheinselbstständigkeit in Frankreich: Definition & Risiken

Seit den 2010er-Jahren prägt die Gig Economy zunehmend den französischen Arbeitsmarkt. Digitale Plattformen schaffen vor allem in Großstädten flexible Beschäftigungsformen, die als modern gelten, jedoch häufig das Risiko der Scheinselbstständigkeit bergen. Viele vermeintlich Selbstständige arbeiten faktisch wie Angestellte - mit rechtlichen Unsicherheiten und dem Verlust sozialer Absicherung.
2. Typische Tätigkeitsfelder innerhalb der Plattformökonomie
3. Gerichtsurteile und gesetzliche Entwicklungen
4. Welche Maßnahmen helfen, Risiken zu vermeiden?

Scheinselbstständigkeit bezeichnet eine Situation, in der eine Person offiziell den Status einer selbstständigen Erwerbstätigkeit innehat, ihre Arbeit aber faktisch wie die eines Angestellten organisiert ist.
Dazu gehört etwa die Ausführung von Aufgaben nach festen Vorgaben, die Bindung an Arbeitszeiten oder die Nutzung von Arbeitsmitteln des Auftraggebers. Auch die wirtschaftliche Abhängigkeit von nur einem Auftraggeber ist ein zentrales Merkmal.
In Frankreich wird die Scheinselbstständigkeit (Salariat déguisé) nicht als eigener Rechtsstatus definiert, sondern als unzulässige Umgehung des Arbeitsrechts bewertet.
Vergleichbare Fragen stellen sich auch in Deutschland, wo sich Betroffene häufig an Spezialisten für Arbeitsrecht in Rosenheim wenden, um ihre individuelle Situation rechtlich einordnen zu lassen.
Was sind die Unterschiede zwischen Selbstständigkeit und abhängiger Beschäftigung?
Echte Selbstständige haben in der Regel mehrere Auftraggeber, legen Preise und Arbeitsweise selbst fest und tragen das unternehmerische Risiko. Sie investieren in eigene Arbeitsmittel und entscheiden frei über Arbeitszeit und Arbeitsort.
Abhängig Beschäftigte hingegen arbeiten nach Vorgaben, sind in die Organisation des Unternehmens eingebunden und genießen dafür umfassenden Schutz: Vom Arbeitslosengeld über die Rentenversicherung bis hin zum Kündigungsschutz.
In der Gig Economy verschwimmen diese Unterschiede, was die rechtliche Einordnung erschwert.
Die Gig Economy betrifft in Frankreich viele Branchen, doch besonders verbreitet ist sie im Transport- und Lieferwesen, bei kurzfristigen Dienstleistungen im urbanen Raum sowie in projektbezogenen digitalen Tätigkeiten. Häufig handelt es sich um einfache Arbeiten, die schnell und flexibel erbracht werden können.
Gerade in Großstädten, wo die Nachfrage nach spontanen Services hoch ist, hat sich die Plattformarbeit etabliert. Viele der Erwerbstätigen sind junge Erwachsene oder Personen mit begrenztem Zugang zum regulären Arbeitsmarkt. Für sie erscheint der Einstieg unkompliziert, doch langfristig kann die rechtliche Unsicherheit zum Problem werden.
Risiken für die Erwerbstätigen
Scheinselbstständigkeit bedeutet für die Betroffenen den Verlust von Arbeitnehmerrechten. Sie haben weder Anspruch auf bezahlten Urlaub noch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.
Auch ein Schutz vor Kündigung existiert nicht, da Aufträge jederzeit beendet werden können. Darüber hinaus sind die sozialen Sicherungssysteme eingeschränkt.
Arbeitslosengeld wird nicht gezahlt, Rentenansprüche bleiben gering, und die Absicherung bei Krankheit oder Unfall hängt von freiwilligen Versicherungen ab, die oft aus Kostengründen nicht abgeschlossen werden.
Aus diesen Gründen befinden sich viele Erwerbstätige in einer permanenten Unsicherheit, die finanzielle und soziale Folgen nach sich zieht.
Folgen für Unternehmen
Auch für Firmen stellt die Nutzung scheinselbstständiger Arbeitskräfte ein erhebliches Risiko dar. Wird ein Vertragsverhältnis nachträglich als abhängige Beschäftigung eingestuft, müssen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern nachgezahlt werden. Zudem kann das Arbeitsverhältnis mit allen gesetzlichen Schutzrechten anerkannt werden.
Neben finanziellen Belastungen drohen auch Bußgelder und Schadensersatzforderungen. In gravierenden Fällen können strafrechtliche Verfahren eingeleitet werden, die nicht nur wirtschaftliche, sondern auch reputative Schäden verursachen.
Unternehmen sind daher gut beraten, ihre Vertragsmodelle kritisch zu überprüfen.

Die französische Rechtsprechung hat mehrfach deutlich gemacht, dass Plattformarbeit nicht automatisch Selbstständigkeit bedeutet. Maßgeblich ist, ob ein Lien de subordination juridique besteht - also ein Unterordnungsverhältnis, in dem Weisungen befolgt, Kontrollen akzeptiert und Sanktionen hingenommen werden müssen.
Ein wegweisendes Urteil stammt vom 4. März 2020 (Cass. soc., n° 19-13.316). Die Cour de cassation stufte die Tätigkeit eines Fahrers rückwirkend als Arbeitsverhältnis ein, weil die Plattform die Arbeitsweise detailliert vorgab, das Verhalten der Fahrer überwachte und bei Abweichungen Sanktionen verhängte.
Parallel zu diesem Urteil arbeitet der Gesetzgeber an Reformen, die Plattformarbeit stärker regulieren sollen. Im Mittelpunkt stehen Mindeststandards für Einkommen, Versicherungsschutz und Mitbestimmung, um die rechtliche Unsicherheit zu verringern und mehr soziale Sicherheit zu schaffen.
Sowohl Auftraggeber als auch Auftragnehmer können Maßnahmen ergreifen, um Risiken zu verringern. Transparente Vertragsbedingungen und eine klare Abgrenzung der Tätigkeit sind entscheidend. Auftragnehmer können freiwillig in Sozialversicherungssysteme einzahlen, um ihre Absicherung zu verbessern.
Betriebe sollten ihre Vertragsmodelle juristisch prüfen lassen und vermeiden, Bedingungen zu schaffen, die faktisch ein Arbeitsverhältnis darstellen. Auch die Zusammenarbeit mit Branchenverbänden oder Gewerkschaften kann helfen, faire Standards zu entwickeln.
Mehr dazu:
- Freelancing in Frankreich: Machen Sie Ihr Hobby zum Beruf
- Als Freiberufler in Frankreich arbeiten: 5 Tipps zur Selbständigkeit
- Mehrfachbeschäftigung in Frankreich: Was erlaubt ist

Olivier Geslin



 Fr
Fr De
De En
En