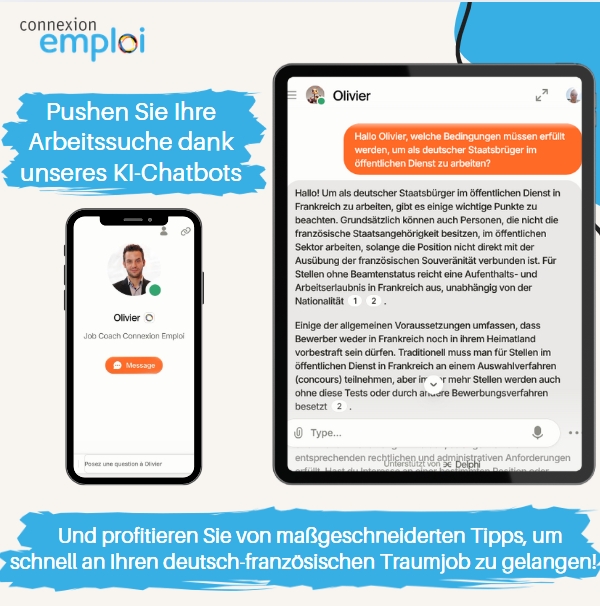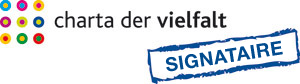Kulturelle Unterschiede in Frankreich und Deutschland im Job

Im Rahmen einer Projektarbeit bitten Sie einen französischen Kollegen um seine Meinung. Nach dessen Durchsicht teilt er Ihnen mit, dass er kaum Verbesserungsvorschläge hat. Erstaunlicherweise verläuft die anschließende Präsentation nicht wie gewünscht, und man wirft Ihnen eine mangelhafte Ausarbeitung vor. Hätte Ihr Kollege die Mängel erkennen müssen oder haben Sie etwas falsch verstanden? Die Gründe hierfür liegen in den unterschiedlichen Kommunikationsmodellen beider Kulturen.
2. Franzosen kommunizieren nicht nur mit Worten
3. Als Deutscher in Frankreich kommunizieren

Deutschland gehört zu den sogenannten Low-Context Kulturen (E.T. Hall). Low-Context bedeutet, dass der Inhalt einer Kommunikation nahezu komplett in Worten formuliert wird.
Es gibt nur sehr wenige Informationen zwischen den Zeilen, oder Informationen, die nicht klar und deutlich ausgedrückt werden. Diese direkte, auch explizite Kommunikation erlaubt den Deutschen unter anderem auch nicht nur Kritik zu äußern, sondern auch offen über Schwächen und Probleme zu diskutieren und diese zielführend zu beheben ohne persönlich zu verletzen.
Im Gegenzug erwartet man weitgehend auch konstruktives, direktes und ehrliches Feedback und weiß dieses ebenfalls sehr zu schätzen.
Der französische Kulturkreis hingegen gehört zu den sogenannten High-Context Kulturen (E.T.Hall) und kommuniziert mittels vielfältiger Kanäle, in denen Mimik und Gestik eine Rolle spielen, aber insbesondere auch die Beziehung zum Gesprächspartner.
So verfügen Franzosen, oft schon vor Austausch von Worten, über einen gemeinsamen Hintergrund, wie z.B.:
- ihre aktuelle berufliche oder private Situation
- eine Beziehung (hierarchisch oder emotional)
- gemeinsame Erfahrungen
- ein geteilter Bildungshintergrund
- etc.
Diese Hintergrundinformation, über die meist alle Gesprächspartner verfügen, der sogenannte Kontext, bildet die Basis der Kommunikation. Da im Idealfall alle Beteiligten der Kommunikation über die gleichen Hintergrundinformationen verfügen und ihre Beziehung zu einander genauestens kennen, entfällt die Notwendigkeit, diese Informationen explizit zu erwähnen, weshalb man den französischen Kommunikationsstil auch als implizite Kommunikation bezeichnet.
Das tatsächlich Gesprochene baut auf dem gemeinsamen und vorausgesetzten Kontext auf und ist nur ein Teil der eigentlichen Kommunikation.
Für explizit kommunizierende Kulturen wie Deutschland bleibt somit ein großer Teil der zur Verfügung stehenden Information unausgesprochen und nicht zugänglich. Oder anders gesagt: man versteht irgendwie nur die Hälfte....
Wie Sie als Deutscher in Frankreich unnötige Fettnäpfchen vermeiden, erfahren Sie in den folgenden 5 Tipps:
Hören Sie stets genau zu, seien Sie aufmerksam und geduldig. Oftmals stehen wesentliche Informationen zwischen den Zeilen und können bei genauerer Beobachtung und ein wenig Erfahrung entdeckt werden.
Versuchen Sie Hintergrundinformationen über Ihre Gesprächspartner zu bekommen. Fragen Sie entweder danach oder holen Sie sich Informationen über Netzwerke ein.
Wenn Sie Zweifel daran haben, ob Sie den vollen Informationsgehalt erfasst haben, fragen Sie nach. Ein "Ja" ist manchmal doch ein "Nein" und entpuppt sich vielleicht erst durch mehrfaches nachhaken als solches.
Versuchen Sie eine vertrauensvolle Beziehung zu Ihren Gesprächspartnern aufzubauen. Dies erleichtert Ihnen den Zugang zu Informationen und bereitet den Weg für zukünftigen Austausch.
Um Ungesagtes leichter zu interpretieren stellen Sie sich stets die 8 W-Fragen: Wer sagt was, wie, wann zu wem, unter welchen Bedingungen? Was ist die Vorgeschichte? Was passiert danach?
Mehr dazu:



 Fr
Fr De
De En
En